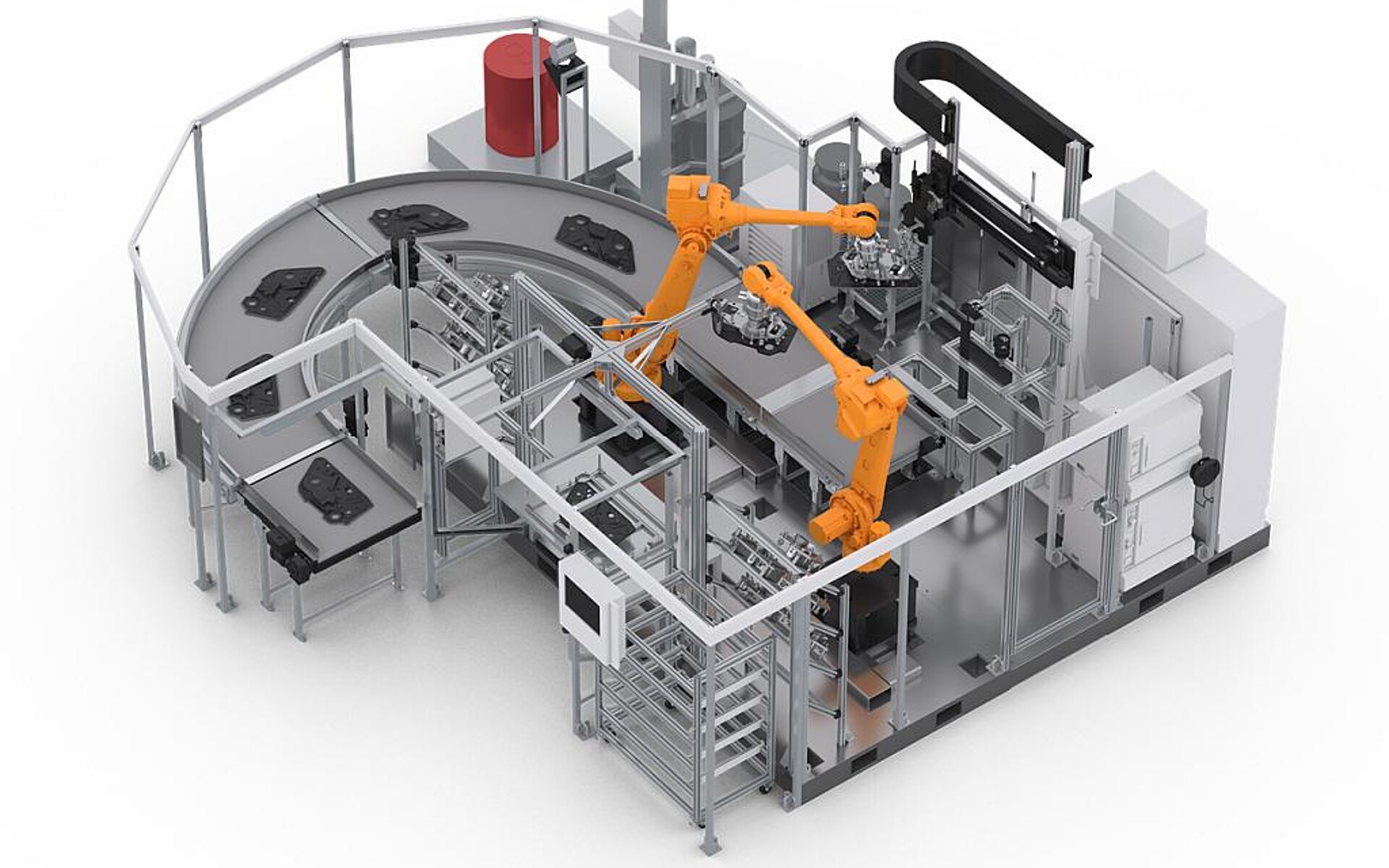Kleidung überträgt virtuelle Berührungen auf die Haut, Displays bestätigen Eingaben mit Nachdruck, sogar Lautsprecher werden ultraleicht: Die dünne Silikonfolie, die all dies möglich macht, bewegt sich nach Wunsch, sie vibriert, klopft, drückt oder zieht – alles nur mit elektrischer Spannung.
Wie sie ihre smarten Folien-Antriebe am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) noch effizienter, stabiler, empfindsamer und schneller machen, haben die Forschungsteams der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki von der Universität des Saarlandes sowie John Heppe von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) kürzlich auf der Hannover Messe gezeigt.
Die Folie ist fast so dünn wie Frischhaltefolie und ein wahrer Tausendsassa. Mit ihr kann das Team der Professoren Seelecke und Motzki den Dingen auf energiesparende Weise neue Fähigkeiten verleihen. Auf Textilien angebracht, macht sie den eigenen Körper in der virtuellen Realität etwa von Computerspielen spürbar. Indem sich die Folie bewegt und mit wohl dosierter Kraft drückt, überträgt sie Berührungsempfindungen auf die Haut. Als dehnbare Schicht im Arbeitshandschuh gibt sie weiter, wie Hand und Finger sich bewegen und lässt den Computer Gesten verstehen. Auf flache Displays zaubert die Folie Knöpfe, Schalter oder Schieberegler, die auftauchen und wieder verschwinden. Sogar stromsparende leichte Lautsprecher, Signalgeber oder schallschluckende Textilien zählen zu den Prototypen, die die Experten für smarte Materialsysteme an der Universität und am Saarbrücker Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) entwickeln.
Spannung bringt Leben in die Folie
Mithilfe elektrischer Spannung kommt Leben in die Folie. „Auf beiden Seiten ist sie mit elektrisch leitfähigen Elektroden beschichtet“, erklärt Paul Motzki, Professor für smarte Materialsysteme für innovative Produktion und Zema-Geschäftsführer. Legen die Forscher hier eine elektrische Spannung an, ziehen sich die beiden gegenüberliegenden Elektrodenschichten durch elektrostatische Kraft an. Dadurch drückt sich die Folie in ihrer Dicke zusammen und wird in ihrer Fläche größer. „Indem wir das elektrische Feld verändern, können wir die Bewegungen der Folie steuern. Sie wird auf diese Weise zu einem leichten, aber effizienten Motor“, erklärt Motzki. Die Forscher können die Folie, ein sogenanntes dielektrisches Elastomer, langsame und schnelle Hub-Bewegungen verrichten oder sie vibrieren lassen. Außerdem hält die Folie kraftvoll jede gewünschte Stellung – letzteres ohne Strom zu verbrauchen.
Mit den Folien entwickelt das Forschungsteam Antriebe, die keine Sensoren brauchen. „Jede Verformung der Folie lässt sich einem Messwert der elektrischen Kapazität zuordnen. Wir können an den Messwerten ablesen, wie sie sich verformt, etwa, wenn über sie gestrichen wird. Die Funktion eines Positionssensors ist also gleich in der Folie selbst mitenthalten“, erläutert Paul Motzki. Anhand der Messwerte programmieren die Forscher mit Künstlicher Intelligenz präzise Bewegungsabläufe und lassen die Folie schwingen, klopfen oder erstarren.
Schwingungen im Ultraschallbereich
Jetzt bekommt die Folie noch mehr Power – auch für neue Anwendungsmöglichkeiten. Sie soll noch stabiler ansteuerbar werden und noch hochfrequenter vibrieren: Ziel ist nicht weniger als Ultraschall. In einem neuen Projekt namens TransDES (Erforschung von Transistorstrukturen auf der Basis flexibler Dielektrischer Elastomer Systeme), das vom Saarland und mit Mitteln des EU-Investitionsfonds EFRE gefördert wird, streben die Forscher sogar nach mehr: Ihre Vision ist eine Elastomer-Platine für Hochspannung. Platinen sind die Basis der meisten Elektrogeräte. Auf diese flachen, heute starren Leiterplatten wird all das aufgelötet, was technische Geräte vom Mixer bis zum Smartphone können müssen. Geht es nach dem Willen der Saarbrücker Forscher, sollen in Zukunft leichte und flexible Folien-Platinen die Logik der Technik enthalten und Elektrogeräten kostengünstiger signalisieren, was sie tun sollen. Minimotoren mit Sensoreigenschaft wären dann gleich in der Folienplatine mit integriert.
Bei dieser Forschung arbeitet das Team von Motzki am Zema mit dem Team von Professor John Heppe von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) zusammen. Die Technologieentwicklung ist nach ihrer Ansicht weltweit einzigartig.
Die Folie erhält dafür eine neue Beschichtung, also neue Elektroden. Bislang besteht die elektrisch leitfähige Schicht auf der Folienoberseite und -unterseite aus Ruß, also Kohlenstoff, der im Siebdruckverfahren aufgedruckt wird. Der elektrische Widerstand, der den Strom bremst, wenn er durch diese Beschichtung fließt, ist hier mit etwa 10.000 Ohm recht hoch – viel zu hoch, soll die Folie im Ultraschallbereich schwingen.

Forscher Sebastian Gratz-Kelly zeigt ein Sensorelement mit metallbeschichteter Folie: Das Touchpad auf dem Armband erkennt Druck und Bewegung des Fingers, der darüberstreicht. Mit maschinellem Lernen und KI kann es Buchstaben und Formen entziffern. (Foto: Oliver Dietze)
Stattdessen sollen nun ultrafeine, besser leitende Metallschichten den Folien-Minimotor ultraschnell an- und abschalten. „Dadurch können wir weit mehr aus der Folie herausholen“, erklärt Doktorand Sebastian Gratz-Kelly. „Auch bei sehr hohen Frequenzen können wir die gesamte Folienfläche nutzen und ansteuern, nicht nur Teile davon. Die Folie wird energieeffizienter, Energieverluste sind geringer, auch dadurch, dass der Übergangswiderstand von Kabel zu Folie geringer ist. Mit einem speziellen Laserverfahren erreichen wir außerdem eine wesentlich kleinere Strukturgröße der Beschichtung“, erklärt der Forscher, der an den smarten Folien arbeitet. „Wir können hierdurch Elektroden im Abstand weniger Mikrometer anbringen, statt wie bisher mit dem Siebdruck im Bereich von etwa einem Zentimeter. Dies macht neue Anwendungen möglich wie etwa eine Elastomer-Platine“, ergänzt Paul Motzki.
Festkörper Metall und dehnbare Folie vereint
Die Herausforderung ist, dass sich die gesamte Folie mitsamt der neuen Metallschichten stark dehnen muss – ein offensichtlicher Widerspruch. Hier kommt das Team von John Heppe ins Spiel. Der Professor für physikalische Sensorik und Mechatronik der htw saar forscht mit seiner Arbeitsgruppe ebenfalls am Zema: An diesem Forschungszentrum arbeiten beide Hochschulen zusammen, um Forschungsergebnisse in die Praxis zu bringen. Heppes Team schafft den Spagat zwischen dem Festkörper Metall und der dehnbaren Folie. Sie bringen hierzu einen Hauch von Metall mit einem speziellen Beschichtungsverfahren auf. „Wir nutzen dabei das sogenannte Sputter-Verfahren. Die leitfähige Schicht, die wir auf dem Elastomer aufbringen, ist mit zehn Nanometern mehr als tausendmal so dünn wie ein Haar“, sagt Mario Cerino, Wissenschaftler im Team von Heppe.

Die Saarbrücker Forschungsteams entwickeln mit den Folien energieeffiziente und kostengünstige Transistoren. Ihre Vision ist eine Elastomerplatine für Hochspannung. Der Forscher Mario Cerino arbeitet an der Herstellung der neuartigen Transistorstrukturen. (Foto: Oliver Dietze)
Der Trick dabei: Die Forscher dehnen das Elastomer und beschichten dann mit der ultradünnen Metallschicht. Den Effekt kennt jeder, der schon mal einen aufgeblasenen Luftballon mit Klebestreifen beklebt hat: Lässt man die Luft raus aus dem Ballon, schnurrt der Klebestreifen wellig zusammen. Ähnliches passiert auch auf der Folie: Die Metallschicht schlägt Falten und das Elastomer hat dadurch Spielraum, um sich auszudehnen. „Wir erreichen auf diese Weise einen Widerstand von 50 bis 100 Ohm auf einer Fläche von zum Beispiel einem Quadratzentimeter, also erheblich niedriger als bisher“, sagt Cerino.
Neue Transistorstrukturen
Derzeit arbeiten die Forscher daran, mit den Folien energieeffiziente und kostengünstige Transistoren auf Silikonbasis zu entwickeln, also elektronische Bauelemente, die elektrische Spannungen und Signale an- und abschalten oder verstärken – und zwar, das ist ihr Ziel: für Hochspannung. „Wie bei einem Wasserhahn, aus dem mehr Wasser fließt, wenn man ihn weiter öffnet, können wir aufgrund des jetzt geringen Widerstandes mehr Strom fließen lassen. So wird auch eine Hochspannungsschaltung möglich für extrem schnelle Schaltzyklen wie beispielsweise für Ventile, Pumpen oder Lautsprecher“, erläutert Cerino. „Wir nutzen hierbei einen besonderen Effekt“, erläutert Professor Heppe. „Wird die Folie mit der Elektrode weiter gedehnt als bei ihrer Beschichtung, entstehen Risse in der Elektrode. Hierdurch steigt der elektrische Widerstand stark an. Dehnt sich die Folie, zeigen sich die Risse. Entspannt sie sich, bilden sich Falten: Die Risse schließen sich wieder. Wir können damit von sehr niedrigen Widerständen zu sehr hohen Widerständen umschalten, vergleichbar mit einem Transistor als elektrischer Schalter“, erklärt Heppe.
Die Forscher demonstrierten ihre Technologie auf der Hannover Messe unter anderem anhand eines neuen Sensorelements mit metallbeschichteter Folie auf einem Stoff-Armband. Dieses berührungsempfindliche Touchpad kann Formen erkennen, die auf ihm gezeichnet werden: Der mit der neuen Beschichtung intelligent gewordene Stoff erfasst Druck und Bewegungsrichtung des Fingers und kann mithilfe maschinellen Lernens und Künstlicher Intelligenz Buchstaben und Formen erraten.