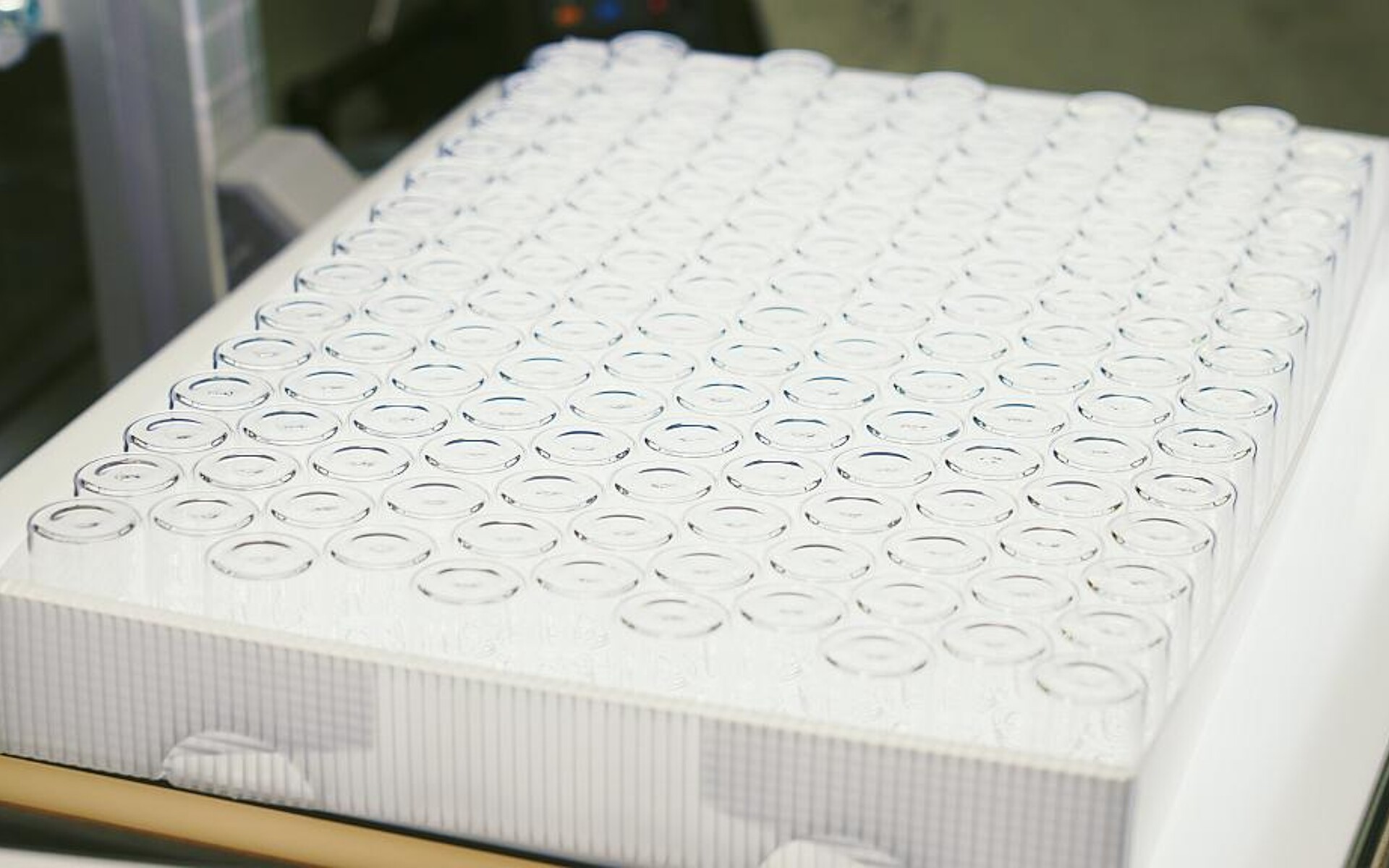Es ist die erste ihrer Art in Europa: an der Medizinischen Universität Graz findet aktuell eine umfangreiche klinische Studie statt, die den kompletten Prozess von Patienten-CT-Scan bis hin zum 3D-gedruckten […]
Es ist die erste ihrer Art in Europa: an der Medizinischen Universität Graz findet aktuell eine umfangreiche klinische Studie statt, die den kompletten Prozess von Patienten-CT-Scan bis hin zum 3D-gedruckten Implantat aus Kunststoff oder Metall abbilden, optimieren und validieren wird. Eine Besonderheit ist die Art der Herstellung der patientenspezifischen Implantate: für derartige additiv gefertigte Implantate existieren noch keine zertifizierten Prozesse, wie sie in der Medizin gefordert werden. Hintergrund sind strenge Richtlinien zur Qualitätssicherung von Implantaten und anderen medizinischen Produkten, die eine lückenlose Nachverfolgbarkeit sowie den Ausschluss von Implantatversagen gewährleisten sollen. Da sich der 3D-Druck noch nicht lange in der Industrie etabliert hat, müssen solche Prozesse zunächst entwickelt und klinisch geprüft werden, bevor sie zertifiziert werden können.

Der speziell für Medizinprodukte konzipierte 3D-Drucker Apium M220 kommt jetzt in einer klinischen Studie zum Einsatz. (Foto: Apium)
Apium ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von 3D-Druckern für die Verarbeitung von Hochleistungsthermoplasten wie PEEK, welches sich aufgrund seiner mechanischen und chemisch-biologischen Eigenschaften bestens für den Einsatz in der Medizin eignet. In der Tat wird PEEK seit geraumer Zeit in der Medizin eingesetzt – allerdings noch in konventioneller Fertigung verarbeitet. Mit einem Materialpreis von 2.000 – 3.000 EUR/kg ein teures Unterfangen, wenn das Implantat dafür aus einem Materialblock gefräst werden muss. In der Regel findet hier ein Materialverlust von bis zu 90 % statt, der dem subtraktiven Charakter des Fräsens unterliegt. Anders der 3D-Druck: bei diesem additiven Fertigungsverfahren wird nur dort Material aufgetragen, wo es benötigt wird. So entsteht Schicht für Schicht ein 3D-Druckobjekt. Der Materialverlust ist gering, da nur in gesonderten Fällen etwaige Überhänge gestützt werden müssen.
Mit der Bereitstellung eines Druckers für die Verarbeitung von PEEK hat Apium einen weiteren Meilenstein erreicht: die klinische Studie soll innerhalb der nächsten drei Jahre weitreichende Ergebnisse zum Einsatz 3D-gedruckter Implantate liefern und ist damit ein wichtiges Projekt auf dem Weg zum 3D-Drucker im OP-Saal.
Das Karlsruher Startup-Unternehmen Apium erforscht, entwickelt und produziert Filamente aus Hochleistungspolymeren für die 3D-Druck Technologie Fused Filament Fabrication sowie die entsprechenden 3D-Drucker zur Verarbeitung dieser.